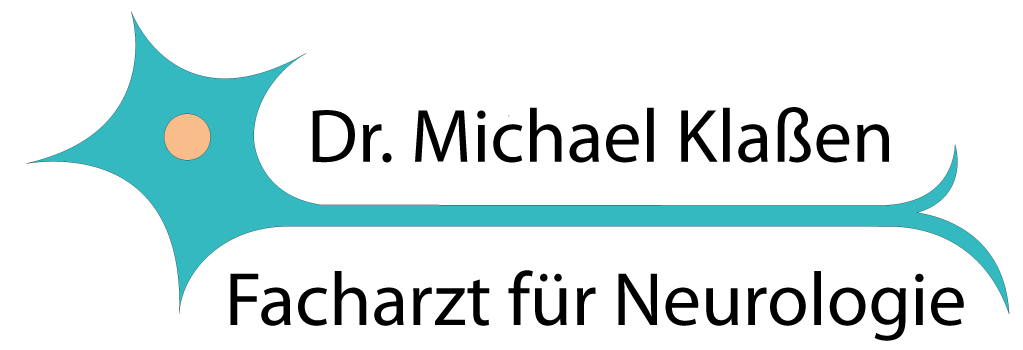Morbus pakinson
Morbus Parkinson
Der Morbus Parkinson ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Die ersten Symptome treten gewöhnlich nach dem fünfzigsten Lebensjahr auf. Die Häufigkeit der Erkrankung steigt nach dem sechszigsten Lebensjahr steil an, so daß ca. 1 bis 1,5 % der über 60jährigen betroffen sind. In Deutschland leiden etwa 250 000 Menschen an dieser Erkrankung.
Die Parkinson‘sche Krankheit entsteht durch einen fortschreitenden Verlust (Degeneration) von Nervenzellen in den tiefen Regionen des Gehirn. Insbesondere gehen dabei Nervenzellen in einem Teil des Hirnstamms, der Substantia nigra, zugrunde. Diese Nervenzellen bilden den neurochemischen Überträgerstoff Dopamin, der wesentlich an der Steuerung und Koordination von unwillkürlichen und automatischen Bewegungen beteiligt ist. Dadurch kommt es in den sogenannten Basalganglien zu einem Dopaminmangel und einem Übergewicht anderer chemischer Überträgerstoffe. Der Körper kann ein Ungleichgewicht zwischen den Botenstoffen lange Zeit ausgleichen. Erst wenn mehr als die Hälfte der dopaminproduzierenden Nervenzellen untergegangen ist, kommt es zu Beeinträchtigungen der Bewegungsabläufe.
Klinische Symptomatik
Als erste Symptome des Morbus Parkinson treten oft eine allgemeine Steifigkeit und Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule und der Muskulatur auf, meist zunächst nur auf einer Körperseite. Im weiteren Verlauf ist die Krankheit dann durch die 4 Hauptsymptome Ruhetremor (Zittern von Händen, Armen, Beinen oder Kopf), Akinese, Rigor und Gang-sowie Haltungsstoerungen charakterisiert. Diese 4 Symtome sind nicht bei allen Betroffenen in gleicher Weise vorhanden. Unter Akinese versteht man eine Verlangsamung und Verminderung willkürlicher u. automatischer Bewegungen, welche sich durch ein vermindertes Mitschwingen der Arme beim Gehen, eine Verminderung der mimischen Ausdrucksfähigkeit (Hypomimie), eine Feinmotorikstörung, eine Verkleinerung des Schriftbildes (Mikrographie), ein kleinschrittiges Gangbild oder Start-Stop-Schwierigkeiten äußern kann. Rigor bedeutet eine Steifheit oder Erhöhung des muskulären Widerstandes bei passiven Bewegungen und kommt durch durch gleichzeitige Anspannung antagonistischer Muskeln zustande. Neben den Kardinalsymptomen finden sich auch vegetative Symptome (vermehrter Speichelfluß u. Talgsekretion, Verstopfung, Inkontinenz, Gewichtsverlust) sowie Muskel- und Gliederschmerzen. Psychische Symptome wie eine Depression (20-60%), verlangsamtes Denken, Alpträume, Angstzustände, Schlafstörungen und eine Demenz (bei 15 -40 % der Patienten) können ebenfalls auftreten.
Diagnose
Bei dem Verdacht auf das Vorliegen einer Parkinson´schen Krankheit werden zur Klärung der Diagnose eine gründliche neurologische und psychiatrische Untersuchung, eine Computer- oder Kernspintomographie des Schädels und ein EEG durchgeführt. In Einzelfällen werden Zusatzuntersuchungen wie der L-Dopa-Test, die Lumbalpunktion zur Liquoruntersuchung und Blutuntersuchungen von speziellen Werten (Kupfer, Coeruloplasmin, Calcium, Entzündungsparameter, immunologische Parameter) notwendig. Eine Frühdiagnose der Erkrankung ist mit Hilfe neuerer bildgebender Verfahren (Positronen-Emissions-Tomographie und Single Photonen-Emissions-Computer-Tomographie) möglich, die bereits in der präklinischen (ohne Symptome) Phase Auffälligkeiten zeigen.
Ursachen (Ätiologie)
Die Ursachen und die Entwicklung der Erkrankung sind noch weitgehend unbekannt. Derzeit wird eine multifaktorielle Verursachung angenommen, die am ehesten aus einer erblichen (genetischen) Störung und einer chronischen Intoxikation bestehen könnte . Der Untergang der dopaminhaltigen Neurone in der Substantia nigra geht wahrscheinlich mit einer Störung der Energieproduktion vermehrter Bildung von Zellgiften einher.
Behandlung (Therapie)
Bis heute gibt es noch keine Heilung der Parkinson‘ schen Erkrankung. Durch den Einsatz von Medikamenten, die den Dopaminmangel ausgleichen, ist aber eine effektive Therapie möglich. Mittels dieser symptomatischen Behandlung ist eine Verbesserung der motorischen Funktionen für einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren zu erreichen. Allerdings kann der Verlauf der Erkrankung, das heißt die Geschwindigkeit der Degeneration der dopaminergen Neuronen, derzeit nicht beeinflußt werden.
Grundsätzlich stehen in der Therapie des Morbus Parkinson mehrere verschiedene Klassen von Medikamenten zur Verfügung. Die wichtigsten sollen das Dopamin-Defizit ausgleichen. Dies kann durch die Gabe des natürlichen Vorläufers des Dopamins (L-DOPA), direkte Dopamin Agonisten oder Medikamente die den Abbau von Dopamin hemmen erreicht werden. Andere wichtige Medikamente sind Hemmer des Überträgerstoffes Glutamat, z. B. Amantadin. Die früher häufig eingesetzten Anticholinergika werden heute wegen der bekannten Nebenwirkungen von den meisten Autoren nur in Ausnahmefällen empfohlen.
Nebenwirkungen der Behandlung
Die wichtigsten frühauftretenden Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und Kreislaufprobleme (orthostatische Dysregulation). Mit zunehmender Dauer der Therapie mit Dopamimetika nimmt die Wirkdauer der L-DOPA-Einzeldosis jedoch ab. Zusätzlich treten als Spätkomplikation nach einigen Jahren bei mehr als 50 % der Patienten charakteristische Überbewegungen (Hyperkinesen oder biphasische Dystonien) und schmerzhafte Verkrampfungen der Muskulatur (Off-Dystonien) auf. Die Latenz zwischen Therapiebeginn und Auftreten dieser Spätkomplikationen ist vom Erkrankungsalter abhängig. Je jünger die Patienten sind, desto schneller werden sie auch die Wirkungsfluktuationen oder Dyskinesien erleben. Eine weitere Komplikation ist das Auftreten von Psychosen unter dopaminerger Medikation. Diese Medikamenten-induzierten Psychosen äußern sich zunächst in ungewohnt lebhaften Träumen, illusionären Verkennungen und später in optischen, seltener auch akustischen Halluzinationen und Wahnvorstellungen.
Tiefe Hirnstimulation
Bei unzureichender Wirksamkeit der medikamentösen Behandlung ist auch die Durchführung von sogenannten stereo-taktischen Operationen, bei denen umgrenzte Bezirke im Gehirn operativ stimuliert werden, um insbesondere den Tremor zu bekämpfen.
Nichtmedikamentöse Behandlung
Weitere Maßnahmen beinhalten Krankengymnastik, Ergotherapie zur Förderung der Feinmotorik und Logotherapie zum Sprachtraining. Psychologische Massnahmen koennen den Betroffenen helfen bei der Verarbeitung der Erkrankung und der damit verbundenen Behinderungen.
Patienten mit einer Parkinson Erkrankung sollten ihre Medikamente nicht direkt nach eiweissreichen Nahrungen einnehmen und auf eine ballaststoffreiche ausgewogene Ernaehrung achten.
Dr.med. Michael A. Klaßen
Facharzt für Neurologie
Fachkunde Geriatrie
Verkehrsmedizinische Begutachtung
Physiotherapeut
Kontaktformular
Ihre Nachricht an uns
Sprechstunde
| Montag | 08:00 – 13:00 Uhr | ——————— |
| Dienstag | 08:00 – 13:00 Uhr | 14:00 – 18:30 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 – 13:00 Uhr | ——————— |
| Donnerstag | 08:00 – 13:00 Uhr | 14:00 – 17:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 – 13:00 Uhr | ——————— |
| Montag | 08:00 – 13:00 Uhr |
| Dienstag | 08:00 – 13:00 Uhr 14:00 – 18:30 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 – 13:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:30 – 12:00 Uhr 14:00 – 17:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 – 13:00 Uhr |
Kontaktinformationen
E-Mail: info@neurologischepraxis-klassen.de
Telefon: 01520 / 2665302
Web: www.neurologischepraxis-klassen.de
Unsere Adresse
Neurologische Praxis
Dr. med Michael Klassen
Im Werkes , 65582 Diez
telefonische Terminvereinbarung:
0152-02665302
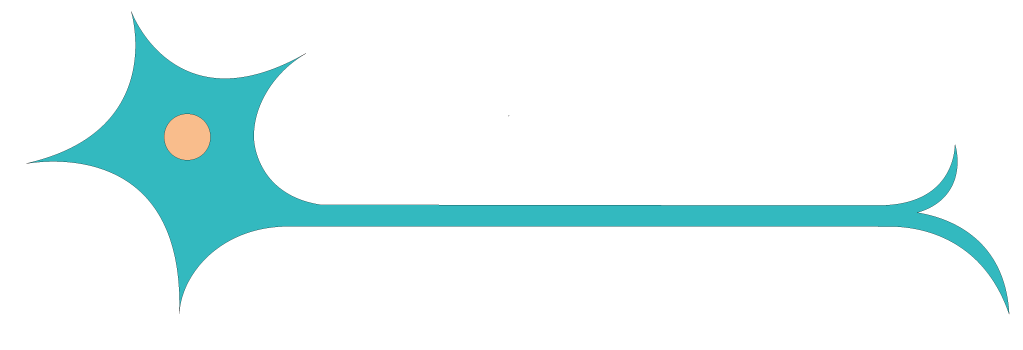
www.neuorologischepraxis-klassen.de
Im Werkes , 65582 Diez
Sie erreichen uns per E-mail unter :
info@neurologischepraxis-klassen.de